Kontakt
Hoher Kontrast
Rheuma würde man als Laie vermutlich nicht bei Kindern vermuten. Dr. med. Andreas Wörner ist genau darauf spezialisiert. Diese Erfahrung möchte er nutzen, um in Basel den Aufbau eines universitären Zentrums für Seltene Krankheiten zu koordinieren. Warum das wichtig ist, zeigt sein Essay zum internationalen Tag für Seltene Krankheiten.

«Warum gerade ich?» – In meiner Rheumatologie-Sprechstunde für Kinder und Jugendliche begegne ich dieser Ur-Frage des Menschen immer wieder. Es sind seltene Erkrankungen, mit denen ich es tagtäglich zu tun habe. Für uns Mediziner ist das ein komplexes Gebiet. Ungleich schwieriger kann es für betroffene Familien sein, damit leben zu müssen.
Die Agenda füllt sich mit Terminen. Arztkontrollen, Medikationen, Physiotherapie. Dazu die ganze Administration. Geldsorgen. Der ganze Familienrhythmus gerät durcheinander. Oft bleibt den ersten Monaten kaum Zeit, sich nebenher auch noch inhaltlich mit der Erkrankung auseinander zu setzen. Und dann, wenn die Weichen für den neuen Alltag einigermassen gestellt sind: «Warum trifft uns das jetzt? Eine seltene Erkrankung!»
Fast noch mehr als die betroffenen Kinder und Jugendlichen fühlen sich die Eltern vor den Kopf gestossen. Denn es ist ja auch unfair. So viel Engagement, damit es dem Kind gut geht, alles perfekt wird – und dann ist es genau das nicht. Oder genauer: Es kommt einem nicht so vor.
Ich habe Familien gesehen, die daran zerbrechen. Viele fühlen sich allein. Da müssen wir unbedingt vorher hellhörig werden. Uns Zeit nehmen. Zeit ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Damit wir der Verzweiflung den Wind aus den Segeln nehmen können. Den Familien klarmachen, sie sind nicht allein. Es gibt ein Netz, das sie auffängt. Andere Betroffene einer seltenen Erkrankung. Aber auch einfach solche, die sie professionell unterstützen können und auf ihrem Weg begleiten.
In der Sprechstunde verwende ich sehr viel Zeit dafür, herauszufinden, welche Unterstützung eine Familie in ihrem Alltag braucht. Was ist wirklich notwendig? Was wäre zu viel und würde das Kind womöglich kränker machen, als es effektiv ist? Das Ziel ist ein hürdenfreier Alltag, so gut das geht.
Neben der Sprechstunde koordiniere ich dann die entsprechenden Termine und Ansprechpartner, von Therapien bis Patientenorganisationen. Und ich bin da für Fragen, sei es am Telefon oder über E-mail. Das ist viel Arbeit. Aber es gibt mir das Gefühl, dass ich Familien in ihrer schwierigen, hoch individuellen Situation wirklich helfen kann. Dennoch bin ich heilfroh, haben wir am UKBB im Care Management sehr erfahrene Sozialarbeiter*innen. Sie greifen mir unter die Arme und sind in der Region Nordwestschweiz hervorragend vernetzt.
In Netzwerken arbeiten ist gerade bei seltenen Erkrankungen der Schlüssel zur bestmöglichen Versorgung. Aus medizinischer Sicht ist zum Teil auch die Diagnosestellung ohne funktionierendes Netzwerk undenkbar. Eine Krankheit gilt in der Schweiz als selten, wenn weniger als eine auf zweitausend Personen betroffen ist. Das trifft bislang auf sieben- bis achttausend Erkrankungen zu. Und es werden jedes Jahr neue entdeckt.
Wie erkennt man nun aus so vielen Krankheitsbildern das richtige Krankheitsbild? Stellen Sie sich ein Puzzle vor. Ist es ein sehr einfaches Puzzle, kann man bereits das fertige Bild erahnen, wenn die ersten drei, vier Puzzlesteine ausgelegt sind. Haben wir es nun mit einer seltenen Erkrankung zu tun, die auf acht Millionen Einwohner vielleicht zwanzig oder dreissig Mal vorkommt, dann ist das, wie wenn wir vor einem schwierigen Puzzle sitzen. Nur dass wir noch nicht mal wissen, aus wie vielen Teilen das Puzzle besteht. Darum müssen manche Betroffene leider schmerzlich lange warten, bis wir ihre Krankheit benennen können.
Um das Bild möglichst rasch und präzise zu erkennen, braucht es den Blick und die Expertise mehrerer Spezialist*innen aus verschiedenen Disziplinen und Spitälern der Schweiz. Und die wiederum sind auf Strukturen angewiesen, die einen möglichst guten Austausch untereinander ermöglichen. So dass sie gleichzeitig an einem Fall sitzen können, vor Ort oder virtuell, ohne dass die Patientenfamilie von Arzt zu Arzt geschickt werden muss und schlimmstenfalls noch widersprüchliche Aussagen zu hören bekommt.
Das Netzwerk Rare Diseases Nordwest- und Zentralschweiz ist genau dafür gedacht. Es vereint Spezialist*innen des UKBB, des Universitätsspitals Basel sowie der Kantonspitäler Baselland, Aarau und Luzern. Gemeinsam können wir Menschen in jedem Lebensalter weiterhelfen – sei es mit der Diagnose einer vermuteten seltenen Erkrankung, sei es mit der Vermittlung der richtigen Spezialist*innen oder sei es mit der täglichen Versorgung. Und all dies wohnortsnah und kompetent. Dies ist so wichtig wie die Diagnose selbst. Wir sollten immer dafür sorgen, dass eine Patientenfamilie möglichst wenig reisen muss. Es erleichtert deren Alltag ungemein.
Die Schweiz möchte in seinem Gesundheitssystem alle Erkrankten mitnehmen. Auch Menschen mit seltenen Erkrankungen sollen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Der politische Wille ist da, diesem hohen Ideal gerecht zu werden. Es bleibt jedoch viel zu tun, auf allen Ebenen.
Wir sollten immer dafür sorgen, dass eine Patientenfamilie möglichst wenig reisen muss. Es erleichtert deren Alltag ungemein.
In Basel haben wir besondere Voraussetzungen, dort weiterzuhelfen, wenn eine seltene Erkrankung sich in einer noch unbekannten Ausprägung zeigt oder noch überhaupt keinen Namen hat. Das UKBB und das Universitätsspital Basel arbeiten Tür an Tür mit der Forschung und Genetik. Das heisst: Wir können auch mal mit einer experimentellen Methode eine vermutet seltene Stoffwechselerkrankung im Labor abklären. Wir können hochindividuell mit einem forschungsbasierten Ansatz die Abklärungen so fortführen, dass es entweder zu einer neuen oder einer seltenen Diagnose führt. Oder kurz: Wir können auch unklaren Beschwerden wirklich auf den Grund gehen.
Diese spezifische Expertise als universitäres Zentrum bringen wir ins Netzwerk Rare Diseases noch stärker ein. In der Hoffnung, dadurch noch mehr Patient*innen den Zugang zu einer hochspezialisierten Medizin verschaffen zu können, die sie einen Schritt weiterbringt.
«Warum ich?» – Als Arzt, der oft mit seltenen, schweren, chronischen Krankheiten in Berührung kommt, sehe ich immer wieder, wie Betroffene zu einem positiven Umgang mit ihrem Schicksal finden und die Ur-Frage umwandeln: «Ich, mit allen Facetten!» – Ein starkes Selbstbekenntnis.
Diese Familien zeigen mir immer wieder aufs Neue: Es ist nicht das Ziel, dass ein Mensch perfekt sein muss. Das ist nicht die Essenz des Lebens. Man kann auch mit einer seltenen Erkrankung glücklich sein. Und wer glücklich ist, wird sich auch gesund fühlen. Egal, was er hat.
Als Gesellschaft tragen wir diesbezüglich aber eine Verantwortung. Und darum freut es mich persönlich ungemein, wenn auch die Politik die Vorteile mehr und mehr honoriert, dass wir Mediziner in Netzwerken denken und handeln. Dass es eine grosse Leistung ist, sich mit Fachpersonen aus allen Disziplinen und Organisationen Hand in Hand für die besonderen Bedürfnisse dieser Menschen einsetzen.
Dieses Netzwerkdenken relativiert auch die Wichtigkeit des Arztes im ganzen Prozess. Weil es eben viel mehr braucht als die Fähigkeit, eine schwierige Diagnose zu erstellen. Diese Entwicklung müssen wir unbedingt weiter fördern. Damit Familien trotz seltener Krankheit in ihrem Alltag bestehen und zu ihrem individuellen Weg finden können.
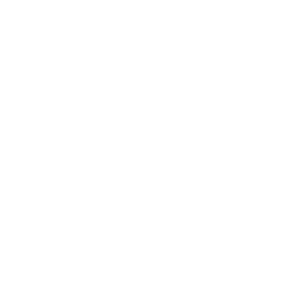
7’000 bis 8’000 Krankheiten gelten als selten. Das ist dann der Fall, wenn die Erkrankung bei weniger als einer auf zweitausend Personen auftritt. Weltweit sind 350 Millionen Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen. In der Schweiz geht das Bundesamt für Gesundheit von 350’000 Kindern und Jugendlichen aus. In der Poliklinik am UKBB machen seltene Erkrankungen rund einen Drittel aller Fälle aus. Im Erwachsenenalter sind es derzeit zwischen fünf und acht Prozent. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren ansteigen – aufgrund der Fortschritte in der Diagnostizierbarkeit und Behandlung erkrankter Kinder und Jugendlicher.
058 387 78 82 (Kosten werden über die Krankenkasse abgerechnet)
Bei Notfällen im Ausland rufen Sie die Notfallnummer Ihrer Krankenkasse an. Die Kontaktdaten finden Sie jeweils auf Ihrer Krankenkassenkarte.
145 (Gift- und Informationszentrum)
Universitäts-Kinderspital beider
Basel, Spitalstrasse 33
4056 Basel | CH
Tel. +41 61 704 12 12
© UKBB, 2025
Die Medgate Kids Line liefert schnell und unkompliziert medizinischen Rat, wenn es Ihrem Kind nicht gut geht. Rund um die Uhr steht Ihnen das medizinische Team unseres Partners Medgate telefonisch zur Verfügung.
Für Notfälle im Ausland: Rufen Sie die Notfallnummer Ihrer Krankenkasse an. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Krankenkassenkarte.
Mehr Informationen: Auf der Seite der Notfallstation finden Sie alles Wichtige zu Verhalten in Notfällen, typischen Kinderkrankheiten und Wartezeiten.
144 Ambulanz
145 Tox Info Suisse (Vergiftungen)
117 Polizei
118 Feuerwehr
Zu welchem Thema möchten Sie uns kontaktieren?
Für Lob oder Tadel nutzen Sie bitte das Feedback-Formular.